- +49 (0)361 262 530
- Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Wochenbericht (884)
Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) präsentiert die neue Ausgabe ihres KulturPflanzen-Magazins. Unter dem Motto „Den Blick über den Tellerrand wagen“ befasst sich die diesjährige Ausgabe mit Themen rund um die wachsende Bedeutung und Vielseitigkeit heimischer Eiweiß- und Ölpflanzen für Ernährung, Landwirtschaft und Klimaschutz. Ackerbohne, Körnererbse, Sojabohne, Süßlupine, Raps und Sonnenblume sind vielseitig nutzbare Kulturpflanzen, die im Trend liegen. Sie spielen eine zunehmend wichtige Rolle für eine ausgewogene Ernährung, eine nachhaltige Landwirtschaft und innovative Forschung.
Hülsenfrüchte sind heute Bestandteil in allen relevanten Ernährungsempfehlungen wie den DGE-Empfehlungen „Gut essen und trinken“, der Ernährungs-Pyramide oder der Planetary Health Diet Berücksichtigung. Sie sind aus einer bewussten Ernährung nicht mehr wegzudenken. Eine Vielzahl von pflanzenbasierten Fleischalternativen zeigen, welches Potenzial im „Eiweiß vom Acker“ steckt. Kreative Rezeptideen, die Lust machen, diese Superfoods selbst auszuprobieren, finden sich in der neuesten Ausgabe des KulturPflanzen-Magazins.
In der Landwirtschaft sind Körnerleguminosen eine wichtige Komponente in der Fruchtfolge. Wie diese tief wurzelnden Hülsenfrüchte zur Bodengesundheit beitragen und wo sie in Deutschland angebaut werden, erfahren Leserinnen und Leser in einem Themenschwerpunkt. Hülsenfrüchte sind auch längst in vielen Teilen der Wissenschaft angekommen, ihr Anwendungsspektrum wächst, wie aktuelle Beispiele im Magazin aufzeigen, so wie die Entwicklung von Kunststoff auf Basis von Süßlupinen.
Rapsöl, das meistverwendete Speiseöl Deutschlands, hat ebenfalls viele Facetten, die im Heft vorgestellt werden. Es dient nicht nur als Lebensmittel, sondern auch als klimafreundliche und nachhaltige Quelle für Kraftstoff. Das beim Pressen entstehende Rapsschrot ist zudem als wertvolles Futtermittel unersetzlich. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie landwirtschaftliche Maschinen auf einem Bauernhof mit selbst gepresstem Rapsöl betrieben werden.
Das KulturPflanzen-Magazin 2025 ist ab sofort digital verfügbar:
>>> Hier geht es zum Magazin. <<<
und kann als Printausgabe kostenfrei bei der UFOP bestellt werden:
Stephan Arens
Tel.: +49 (0)30/235 97 99 10
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Über 100 Landsenioren aus ganz Thüringen trafen sich am 26. Juni zur Jahrestagung in Apfelstädt. Viktoria Kißlinger vom Landesseniorenrat Thüringen informierte über die Struktur, die Aufgaben und die Arbeitsinhalte des Landesseniorenrates. In diesem Gremium wird die Arbeit von Seniorenbeauftragten und Seniorenbeiräten in den einzelnen Kreisen in Thüringen koordiniert und deren Zusammenarbeit gefördert. Seniorenbetreuung, häusliche Pflege, Umgang mit modernen Medien und Fragen und Probleme der Menschen im Ländlichen Raum sind die Themen mit denen sich der Landesseniorenrat befasst. Weiterhin sind neun berufene Bürger aus Organisationen, die sich mit Seniorenarbeit befassen, integriert. Viktoria Kißlinger bedankte sich bei Präsident Gerold Schmidt, der Mitglied im Landesseniorenbeirat ist, dass er die Anliegen der älteren Menschen im Ländlichen Raum in die Arbeit dieses Gremiums einbringt.
Mit großem Beifall begrüßten die Veranstaltungsteilnehmer den Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt. Das Motto der Landsenioren, "Einander helfen, Freude erleben", sei eigentlich ein Motto für ganz Thüringen, betonte er zu Beginn seiner Rede. Seine Aussage: „Wir müssen wieder mehr die Stärken unseres Landes herausstellen und stolz auf Thüringen sein“, zog sich wie ein roter Faden durch seine gesamten Ausführungen.
Über das 100-Tage-Programm hinaus sieht Voigt 3 Schwerpunkte.
1. Wirtschaftliches Wachstum für Thüringen
2. Bürokratie abbauen
3. In Bildung und medizinische Versorgung investieren
Der Ausfall von Schulstunden und die unbesetzten Hausarztstellen betrachtet der Ministerpräsident als große Probleme, die jetzt angegangen würden.
Änderungen werde es beim Bürgergeld geben, aber das Renteneintrittsalter werde nicht erhöht. Vielmehr setze die Regierung auf eine Aktivrente, die es für Rentner attraktiver mache, zu arbeiten.
Auf Anfrage erklärte Mario Voigt, dass der Wolf ins Jagdgesetz aufgenommen wird, nachdem vom Bund die Voraussetzungen geschaffen sind.
Viele Fragen zu Themen wie Mindestlohn, Digitalisierung, Bürokratieabbau, Rente und Haushaltspolitik musste der Ministerpräsident beantworten. Gerold Schmidt wies auf die wichtige Rolle des ländlichen Raumes und seiner Einwohner hin und versicherte, dass die Landsenioren sich aktiv einbringen.
Zweiter Höhepunkt der Veranstaltung war ein Vortrag von Prof. Dr. Stefan Michel von der TU Dresden über die Geschehnisse des Bauernkrieges 1525. Anschaulich legte er dar, wo überall Aktivitäten stattfanden und dass Thüringen eines der Zentren der Bewegung war.
Prof Michel analysierte die regional sehr unterschiedlichen Forderungen der Aufständischen und wies das an Beispielen von Neustadt/Orla und Ichtershausen nach. In der Mehrzahl ging es vor allem um Freiheit, Gerechtigkeit, Bildung, wirtschaftliches Wachstum und Freiheit in der Glaubenslehre. In den Forderungen der Aufständischen, die nicht nur Bauern waren, sahen viele Teilnehmer der Jahrestagung Parallelen zur heutigen Situation.
weiter...
Mindestlohnkommission legt neue Anpassung vor: Ausnahmeregelung für Obst-, Gemüse- und Weinbau bleibt erforderlich
Uwe Ropte Montag, 30. Juni 2025Die Mindestlohnkommission hat am 27. Juni beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn in zwei Stufen anzuheben:
-
auf 13,90 Euro brutto je Stunde zum 1. Januar 2026,
-
auf 14,60 Euro brutto je Stunde zum 1. Januar 2027.
Der Beschluss wurde einstimmig auf Grundlage eines Vermittlungsvorschlags der Vorsitzenden gefasst. Die Bundesregierung kann diese Empfehlung per Rechtsverordnung umsetzen. Eine Abweichung vom Vorschlag ist nicht vorgesehen.
Auch wenn die ursprünglich diskutierte Erhöhung auf 15 Euro nicht beschlossen wurde, stellt die nun geplante Anhebung insbesondere für den arbeitsintensiven Obst-, Gemüse- und Weinbau eine erhebliche Herausforderung dar. In diesen Bereichen liegen die Lohnkosten bei bis zu 60 Prozent der Produktionskosten.
Vor diesem Hintergrund bekräftigt der Gesamtverband der land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände e. V. (GLFA) seine Forderung nach einer sektoralen Ausnahmeregelung. Diese wurde bereits im Rahmen der Bundestagswahlforderungen 2025 erhoben. Zwar wurde eine solche Regelung nicht im Koalitionsvertrag verankert, allerdings wächst innerhalb der Politik die Bereitschaft, eine Ausnahmeprüfung ernsthaft zu erwägen. Bundeslandwirtschaftsminister Rainer hat angekündigt, derzeit die rechtliche Zulässigkeit einer Ausnahme prüfen zu lassen.
Ein Blick auf die internationale Wettbewerbssituation verdeutlicht die Dringlichkeit: In vielen EU-Staaten liegen die gesetzlichen Mindestlöhne deutlich unter dem deutschen Niveau (z. B. Spanien: 8,37 Euro, Polen: 7,08 Euro, Rumänien: 4,87 Euro). Bei fortschreitender Kostenbelastung droht ein weiterer Rückgang der heimischen Produktion – mit Auswirkungen auf Anbauflächen und Selbstversorgungsgrad. Schon heute liegt dieser laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft bei Obst nur bei 23 Prozent, bei Gemüse bei 36 Prozent.
Der GLFA spricht sich deshalb für eine praxisnahe Lösung aus, um die Betriebe in den besonders betroffenen Bereichen gezielt zu entlasten und damit den Fortbestand regionaler landwirtschaftlicher Erzeugung zu sichern.
Benachteiligte Gebiete unter Druck: IG BENA übergibt klare Botschaft an das Ministerium
Anja Nußbaum Samstag, 28. Juni 2025Am Freitag (27. Juni) fand das diesjährige Jahresgespräch der Interessengemeinschaft der Betriebe in benachteiligten Gebieten (IG BENA) mit Ministerin Colette Boos-John sowie Staatssekretär Marcus Malsch vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TMWLLR) statt. Am Jahresgespräch nahmen zudem der Präsident des Thüringer Bauernverbandes (TBV), Dr. Klaus Wagner sowie die Fachabteilung Agrarförderung des Ministeriums teil.
Aufgrund des engen Zeitplans der Ministerin wurde das Treffen nicht wie üblich auf einem Betrieb im BENA-Gebiet durchgeführt, sondern in den Räumen des TBV.
Die Vorsitzende der IG BENA, Astrid Hatzel, stellte die Entstehungsgeschichte der Interessengemeinschaft sowie die Hintergründe der benachteiligten Gebiete vor. Sie sprach eine erneute Einladung an die Ministerin aus, um sich vor Ort ein Bild von den besonderen Herausforderungen der Region zu machen.
Zur Veranschaulichung der konkreten Problemlagen präsentierte Simone Hartmann am Beispiel der TZG Ernstroda eindrucksvoll die vielfältigen Herausforderungen, mit denen die Betriebe konfrontiert sind: Weidewirtschaft, Fachkräftemangel, steigende Lohnkosten, Aufgabe einzelner Betriebszweige, zersplitterte Flächenstrukturen sowie zunehmende technische Anforderungen – etwa durch das Satellitenmonitoring, die FAN-App oder PORTIA. Dabei wurde deutlich: Viele dieser Herausforderungen sind nicht nur organisatorischer, sondern auch finanzieller Natur.
Ministerin Boos-John zeigte Verständnis für die existenziellen Sorgen der Betriebe und betonte die Bedeutung ihrer Resilienz. Sie äußerte Zuversicht, dass das Ministerium mit seiner starken personellen Aufstellung einen Beitrag zur Zukunftssicherung der Landwirtschaft leisten könne. Die Digitalisierung spiele dabei eine zentrale Rolle – auch wenn sie einräumte, dass der tatsächliche Digitalisierungsgrad in den Betrieben bislang hinter den Erwartungen der Verwaltung zurückbleibe.
Für den Spätsommer kündigte die Ministerin eine Sommertour mit Betriebsbesuchen an. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer habe seinen Besuch in Thüringen in Aussicht gestellt. Hinsichtlich finanzieller Unterstützung sprach sie von einem Balanceakt zwischen einem angespannten Landeshaushalt und dem Bedarf an effektiven Förderinstrumenten. Umso wichtiger sei ein regelmäßiger, sachlicher Dialog mit den Betroffenen.
Staatssekretär Malsch informierte über die aktuelle Entwicklung zur Ausgleichszulage. Zwar sei der ursprünglich angestrebte Zuschuss von 20 Millionen Euro nicht realisierbar gewesen, dennoch konnte die geplante Summe für 2026 und 2027 von zunächst 12 auf jeweils 16 Millionen Euro angehoben werden – ein wichtiger Schritt, auch wenn es sich um einen konsumtiven Haushaltstitel handelt.
In der anschließenden Diskussion machten die Vorstandsmitglieder der IG BENA deutlich, welche massiven wirtschaftlichen Auswirkungen die Kürzung der Ausgleichszulage für die Betriebe hat. Zusätzlich verwiesen sie auf zahlreiche weitere Belastungen, die mit der Bewirtschaftung benachteiligter Flächen einhergehen: Personalmangel, Mindestlohn, hoher Arbeitsaufwand für Weidehaltung, fehlende Einkommensalternativen sowie technische Hürden – insbesondere im Umgang mit der FAN-App.
Ein wesentlicher Kritikpunkt betraf die unzureichende Kommunikation seitens des Ministeriums – sowohl in Bezug auf die Funktionalität der digitalen Systeme als auch hinsichtlich der Nachweispflichten in den Förderverfahren.
Nach dem Erscheinen des Artikels vom 5. Juni über die Investor Days Thüringen gab es bereits erste interessierte Betriebe, die sich als Testbetriebe für die Software von Pheno-Inspect gemeldet haben. Die Software erstellt auf Basis von Drohnenaufnahmen hochauflösende Informationskarten von Feldschlägen und kann gezielte Empfehlungen für punktuelle Pflanzenschutzapplikationen geben. Weitere Informationen zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten finden Sie über den untenstehenden Link auf der Website des Unternehmens. Die Software richtet sich an Landwirte, die ihre Flächen digital überwachen möchten, Lohnunternehmer, die datenbasierte Dienstleistungen anbieten und Berater für digitale Lösungen in der Agrarpraxis.
Direkt hier oder über den QR-Code werden Sie direkt zum Kontaktformular geleitet:
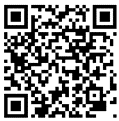
Nach der Beantwortung weniger Fragen meldet sich das Unternehmen bei Ihnen zurück.
Anpassung der Ausgleichszulage ab 2026: Kritik an Verfahren und Datenbasis
Anja Nußbaum Mittwoch, 25. Juni 2025Im November 2021 wurden die Betriebe in benachteiligten Gebieten darüber informiert, dass das Budget für die Ausgleichszulage ab dem Jahr 2026 von rund 20 Millionen Euro auf 12 Millionen Euro reduziert werden muss. Um eine pauschale Kürzung über alle Beihilfegruppen hinweg zu vermeiden und stattdessen die wirtschaftlichen Besonderheiten der einzelnen EMZ-Gruppen mit entsprechender Tierhaltung zu berücksichtigen, wurde in einem ersten Entwurf eine Anpassung des Beihilfeschlüssels vorgenommen.
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Online-Veranstaltung: Sächsische Schwimmschicht-Projekt (TA-Luft)
Olivia Meyer Dienstag, 24. Juni 2025Die TA-Luft fordert künftig bei der Lagerung von Gülle und Gärresten eine Einsparung von Ammoniak- und Geruchsemissionen um mindestens 85 Prozent in Altanlagen. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat in diesem Zusammenhang ein Projekt durchgeführt, bei dem geprüft wurde, ob
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Blick nach vorn: Förderpolitik ab 2028 im Fokus des Fachausschusses Agrarpolitik
Anja Nußbaum Dienstag, 24. Juni 2025Im Mittelpunkt der Sitzung des Fachausschusses Agrarpolitik des Thüringer Bauernverbandes am 23. Juni standen die Perspektiven der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2028 sowie Veränderungen bei den Fördermöglichkeiten auf Landesebene.
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Am 19. Juni führte der Kreisbauernverband Greiz-Gera seine Flurfahrt durch, die in diesem Jahr dem Gedenkjahr zum Bauernkrieg gewidmet wurde und deshalb nach Bad Frankenhausen in den Kyffhäuserkreis führte.
Anlässlich des 500-jährigen Gedenkjahres des Deutschen Bauernkrieges reisten die teilnehmenden KBV-Mitglieder, der Referatsleiter der Zweigstelle des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und ländlichen Raum in Zeulenroda-Triebes sowie die landwirtschaftliche Vertretung der Sparkasse Gera-Greiz, in das Panoramamuseum und das Regionalmuseum. Aufgrund der Nähe zu Greußen wurde im Anschluss der Ziegenhof Peter besucht.
Den Beginn machte eine Audioguide-Führung unter kunsthistorischer Betrachtung und dem Entstehungsprozess des Monumentalgemäldes von Werner Tübke, ergänzt durch die Thüringer Landesausstellung „freiheyt 1525-500 Jahre Bauernkrieg“ im Panoramamuseum. Es folgte eine thematisch vertiefende Führung durch die Sonderausstellung „500 Jahre Bauernschlacht bei Frankenhausen“ mit der Präsentation von Objekten aus der Zeit um 1525 im Regionalmuseum Bad Frankenhausen.
Anschließend wurden die Teilnehmenden durch Dr. Katja Peter und Dr. Wolfgang Peter, Vizepräsident des Thüringer Bauernverbandes und Vorsitzender des Bauernverbandes Kyffhäuserkreis, auf dem Familienbetrieb Ziegenhof Peter in Greußen empfangen. Familie Peter informierte die Gruppe über die Zucht ihrer Thüringer Waldziegen und weitere alte Haustierrassen. Bei einem Hofrundgang verwiesen die Peters zudem über ihre ackerbaulichen Kulturen, ihre Hofkäserei, die Direktvermarktung und die Vielfältigkeit ihrer Produkte.
Mit zahlreichen Eindrücken traten die Teilnehmenden der Flurfahrt des KBV Greiz/Gera ihre Heimreise an.
Ein herzlicher Dank gilt allen Teilnehmenden und den Gastgebern der Flurfahrt.
Der europäische Bauernverband Copa Cogeca hat eine Petition gestartet, die sich klar gegen die geplante Schwächung des eigenständigen GAP-Budgets im nächsten EU-Finanzrahmen ab 2028 richtet. Unter dem Motto „No security without CAP“ soll ein starkes Signal an die EU-Kommission gesendet werden – für Ernährungssicherheit, bäuerliche Existenzen und lebensfähige ländliche
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Fachausschüsse Sozialpolitik der ostdeutschen Bauernverbände tagten in Erfurt
Cornelia Müller Montag, 23. Juni 2025Am 18. Juni fand auf Einladung des Thüringer Bauernverbandes die gemeinsame Sitzung der Ausschüsse Sozialpolitik der Landesbauernverbände Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Erfurt statt. Der Vorsitzender des Fachausschusses Sozialpolitik des Thüringer Bauernverbandes (TBV) Uwe Kühne begrüßte die Teilnehmenden und eröffnete die Sitzung mit einem Überblick zu aktuellen Entwicklungen aus der Vertreterversammlung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).
Im Mittelpunkt seines Berichts stand die Einführung eines neuen Beitragsmaßstabs in der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) ab 2025, die zu teils erheblichen Verschiebungen in den Beitragsklassen führt. Weitere Themen waren unter anderem die finanzielle Anerkennung von Parkinson als Berufskrankheit, die Anpassung der landwirtschaftlichen Renten um 3,74 Prozent zum 1. Juli sowie die Bedeutung praxisnaher Präventionsangebote – etwa Motorkettensägenlehrgänge für Auszubildende.
Die Diskussion zeigte, dass bei der Beitragsbemessung auf Grundlage des Standarddeckungsbeitrags noch Nachbesserungsbedarf besteht, insbesondere im Hinblick auf die Einstufung nach Katasterarten und Landkreisen. Angeregt wurde auch, Lehrgänge stärker zu bündeln und regional besser zu fördern.
Einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt bildeten die Vorträge von Anke Friedrich vom Deutschen Bauernverband (DBV), die sowohl Unterschiede zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung als auch die Rolle von Gesellschaftern in der LKK beleuchtete. Gerade Letzteres erwies sich als sehr komplexes Thema, das einer intensiven Beratung im Einzelfall bedarf.
Heike Sprengel von der SVLFG stellte die umfangreichen Gesundheitsangebote der SVLFG anschaulich vor. Die Teilnehmenden erhielten Informationsmaterialien sowie eine Übersicht über präventive Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheit im landwirtschaftlichen Arbeitsumfeld.
Zum Abschluss der Sitzung berichteten Ausschussmitglieder über ihre Arbeit in den Renten- und Widerspruchsausschüssen der SVLFG. Dabei wurde insbesondere der Wunsch nach größerem Entscheidungsspielraum in Härtefällen geäußert.
Der TBV bedankt sich bei allen Teilnehmenden sowie den Referentinnen und Referenten für ihre engagierten Beiträge und die konstruktive Diskussion.
Die Vorträge aus dem Fachausschuss Sozialpolitik finden Sie hier:
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Der Thüringer Braugerstenverein lädt ganz herzlich zur Thüringer Braugerstenrundfahrt ein. Die Rundfahrt findet erstmals im Burgenlandkreis im benachbarten Sachsen-Anhalt statt. Gemeinsam mit dem Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum und dem Sieger des Braugerstenwettbewerbs 2024, der Agrargenossenschaft Gleina e.G., werden Ihnen im Rahmen einer Sortendemonstration 12 Braugerstensorten vorgestellt. Vor Ort können Sie sich ein Bild des Braugerstenjahrgangs 2025 machen. Die Sortendemonstration und weitere Praxisschläge werden mit Bussen angefahren.
Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Brauerei Landsberg GmbH und Josef Breun Morgenrot GmbH & Co. KG. Alle Informationen und die Anmeldung finden Sie hier und unter
www.th-braugerstenverein.de oder www.agrarmarketing-thueringen.de/veranstaltungskalender/.
Am vergangenen Mittwoch (18. Juni) fand die Gremienversammlung von Arla und DMK statt. Wie die beiden Molkereien im Anschluss an die Gremienversammlungen bekanntgaben, wurde der geplanten Fusion zugestimmt. Mit der gebündelten Kraft zweier bedeutender genossenschaftlicher Molkereien sollen neue Maßstäbe gesetzt werden. Die neue, fusionierte Molkerei wird künftig unter dem Namen Arla firmieren und ihren Sitz im dänischen Viby J haben, die DMK Group wird zukünftig als Juniorpartner fungieren. Die endgültige behördliche Prüfung soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Bis dahin arbeiten die beiden Molkereien unabhängig voneinander weiter.
Zukünftig werden, gesetzt der erfolgreichen Zusammenführung, rund 8 Mrd. kg Milch aus Deutschland an Arla geliefert, was etwa 12 Prozent der deutschen Milchmenge entspricht. Mit dieser Stärkung ist aus Erzeugersicht eine Erwartung an Stabilität und stärkerer Marktposition gegenüber dem Lebensmittelhandel sowie zu verbesserten Auszahlungsleistungen für die Milcherzeuger verbunden. In diesem Sinne wird der Bauernverband den Transformationsprozess konstruktiv-kritisch begleiten. Es besteht aus Sicht des Deutschen Bauernverbandes darüber hinaus die Herausforderung, bei Mehrwertprogrammen, diese mit der aktuellen Entwicklung einer einheitlichen Berechnungsmethodik für die Klimabilanzierung in Einklang zu bringen.
Das mdr Thüringen Journal berichtete zur "Fusion in der Milchwirtschaft" und hinterfragte, was das für den DMK-Standort Erfurt heißt. Den Beitrag sehen Sie hier: MDR THÜRINGEN JOURNAL
Vorstandssitzung im KBV Saalfeld-Rudolstadt: Austausch mit Landrat Wolfram
KBV Freitag, 20. Juni 2025Der Kreisbauernverband (KBV) Saalfeld-Rudolstadt traf sich am Donnerstag (19. Juni) zu einer Vorstandssitzung in der Agrar-GmbH „Saalfelder Höhe“ in Kleingeschwenda. Zu Gast waren Landrat Marko Wolfram und Jan Scheinert, Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes.
Gemeinsam diskutierten die Teilnehmer aktuelle Herausforderungen der regionalen Landwirtschaft. Im Mittelpunkt stand die zunehmend schwierige Lage vieler landwirtschaftlicher Betriebe – insbesondere angesichts der erwarteten Ernteausfälle durch die anhaltende Hitze.
Ein intensiver Austausch fand zur Zusammenarbeit mit dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt statt. Dabei ging es unter anderem um Beratungsangebote, Kontrollabläufe und die Bedeutung einer vertrauensvollen Kooperation zum Schutz von Tierwohl und Versorgungssicherheit.
Besonders deutlich wurde Landrat Marko Wolfram bei einem weiteren zentralen Thema: dem Bürokratieabbau. „Die Betriebe benötigen mehr Handlungsspielraum und weniger Bürokratie. Ich fordere die Landesregierung auf, ihren Versprechen zum Bürokratieabbau jetzt auch konkrete Taten folgen zu lassen“, sagte Wolfram.
Auch die gekürzte Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten und spezifischen Gebieten des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum war Gegenstand der Diskussion. Der Kreisbauernverband appellierte gemeinsam mit dem Landrat an das Land, die Förderprogramme wieder zu stärken. „Strukturschwache ländliche Räume brauchen gezielte Unterstützung, um ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern“, so der gemeinsame Tenor.
Am 19. Juni lud der Regionalbauernverband Südthüringen zu einer weiteren Flurfahrt ein - diesmal ging es in den Landkreis Sonneberg. Die Geschäftsführerin der Agroprodukt Sonneberg e.G. und Gastgeberin, Franziska Rosenbauer begrüßte Gäste und Berufskollegen.
Bei der anschließenden Begehung des Betriebsgeländes wies Rosenbauer auf vielfältige Herausforderungen hin, vor denen sie, aber auch die anderen Landwirte, zur Zeit stehen. Hier wurde z.B. die Überdachung von Güllelagerstätten besprochen. Herr Greiner-Adam von der Unteren Immissionsschutzbehörde erklärte dazu Zusammenhänge und Rechtsgrundlagen. Er lobte die enge Zusammenarbeit mit den anwesenden Landwirten und bot auch weiterhin Hilfe und Kooperation bei allen auftretenden Problemen an.
Als weitere Herausforderung wurde die Ungewissheit bei der Betreibung von Biogasanlagen angesprochen. Nach langer Wartezeit ist eine neue Überdachung der Anlage, verbunden mit hohen Reparaturkosten, fast fertiggestellt. Doch ob sich diese und weitere Investitionen gelohnt haben, weiß niemand, so Rosenbauer. Kai Zerrenner von der Agrargenossenschaft Schalkau e.G. stand ebenfalls vor riesigen Investitionen zur Flexibilisierung seiner Biogasanlage und entschied sich dagegen. Die politische und gesetzliche Lage sei so ungewiss, dass er dieses Risiko für seinen Betrieb nicht tragen könne. Somit wird wieder eine Biogasanlage vom Netz gehen.
Weitere Gesprächsthemen, zu denen man sich austauschte, waren der Biber und der Wolf, aber auch die Blauzungenkrankheit und die Erfahrungen der Landwirte damit.
Das Kooperationsangebot der anwesenden Behörden wurde von den Landwirten gelobt - das gute Miteinander wird weitergeführt, bekundeten alle Teilnehmenden der Flurfahrt.
Gemeinsame Tagung Fachausschuss Getreide und Ökologischer Landbau des DBV
André Rathgeber Freitag, 20. Juni 2025Am 18. Juni fand zum ersten Mal der Fachausschuss Getreide und der Fachausschuss Ökologischer Landbau des Deutschen Bauernverbandes (DBV) als gemeinsamer Ausschuss statt. Neben der Sitzung hatten die Vertreter aus Haupt- und Ehrenamt die Möglichkeit, den 5. Öko-Feldtag in Canitz bei Wurzen zu besuchen. Die Öko-Feldtage fanden erstmalig auf den Flächen des Biolandbetriebes Wassergut Canitz GmbH (Sachsen) statt. Hier ist die enge Verbindung zwischen ökologischer Landwirtschaft und dem Schutz des Trinkwassers ein zentrales Thema.
Nach einer Führung über das Gelände fand der gemeinsame Ausschuss statt. Auf der Tagesordnung standen Themen wie neue Züchtungsmethoden, die Schilf-Glasflügelzikade und die Diskussion um die Erntegutbescheinigung. Zu letztgenannten gibt es nach wie vor keine Einigung zwischen der Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (STV), dem Handel und dem DBV. Die nicht vorhandene Kompromissbereitschaft der STV gegenüber dem Handel und der Landwirtschaft ist nicht zu verstehen und entzieht sich jeder Grundlage. Das Urteil des BGH schwebt wie ein Damoklesschwert darüber und so beharrt die STV weiterhin, auf die umfangreiche Dateneinreichung der Landwirtschaft. Die Lage ist verworren, die Fronten verhärtet. Eine allgemeingültige Empfehlung für die Landwirtschaft kann leider immer noch nicht gegeben werden.
Schilf-Glasflügelzikade
Laut dem Monitoring des Informationssystems für die integrierte Pflanzenproduktion (ISIP) ist Thüringen nach wie vor von der Schilf-Glasflügelzikade nicht betroffen. Das ist gut aber zwingt einen dennoch zur Wachsamkeit. Warum ist diese Zikade so gefährlich? Welche Kulturen sind betroffen und wie sieht die Bekämpfungsstrategie aus? Einen Einblick gab Anna Dettweiler vom Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer-Verband, die Teamleiterin des SONAR-Projektes ist. Die Zikade als solches ist nicht das Problem. Diese lebt schon länger in unseren Breitengraden. Das eigentliche Problem liegt in den übertragenen bakteriellen Erregern Candidatus Phytoplasma solani und Candidatus Arsenoponus phytopahogenicus, die die beiden Krankheiten Syndrom Basses Richesses (SBR) und Stolbur auslösen. Über Frankreich kommend, breiten sich diese Erreger über Süd-Westen immer weiter über das Bundesgebiet aus. In Thüringen ist bislang keine befallene Zikade im Rahmen des Monitoring entdeckt wurden.
Warum ist die Zikade so gefährlich?
Der Anflug auf die Felder erfolgt wellenartig über einen Zeitraum von Mitte Mai bis in den Frühherbst hinein. In der Zeit beißen sich die Zikaden an den Pflanzen fest. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier im Boden ab. Daraus schlüpfen die teilweise bereits infizierten Nymphen im Boden, wandern und docken sich an verschiedenen Pflanzen an und ernähren sich. Bei warmen Phasen im Frühjahr kriechen die Nymphen aus dem Boden und fliegen an nahegelegene Wirtspflanzen - so schließt sich der Kreis. Adäquate Mittel zur Bekämpfung sind nicht vorhanden, Forschungsergebnisse befinden sich aktuell in der Erarbeitung.
Stolbur
Stolbur ist weiter auf dem Vormarsch: Symptome eines Befalls sind neben gelben, verwelkten, absterbenden Blättern sogenannte "Gummirüben" – weiche, biegsame Rüben, die aufgrund ihrer Schädigung oft schlecht zu ernten und zu verarbeiten sind. Zwar ist der Zuckergehalt dieser Rüben nicht reduziert (zum Teil sogar erhöht), die Erträge gehen jedoch insgesamt stark zurück und die Rüben sind kaum lagerfähig. Problematisch ist, dass bisher nicht infizierte Zikaden durch den Saft von infizierten Rüben die Erreger aufnehmen und so zum Überträger werden können.
Weitere Kulturen zeigen Schäden auf
Aus dem Fachausschuss heraus gab es die Information, dass mittlerweile auch andere Kulturen, wie Kartoffeln, Möhren, Rote Bete, Zwiebeln aber auch Rhababer, betroffen sind und typische Symptome, wie gummiartige Fruchtkörper oder Welke, aufweisen. Für die Natur als solches kann dies auch zum großen Problem werden. Es sind Fälle von infizierten und krankem Löwenzahn bekannt geworden. Das zeigt, wie wandelbar dieser bakterielle Erreger ist. Ein Umstand welcher unbedingt auf allen Ebenen bekannt zu machen ist.
„SBR“-Krankheit
Im Gegensatz zu Stolbur ist die bakterielle „SBR“-Krankheit bei Zuckerrüben seit einigen Jahren festzustellen. Der Zuckergehalt der Rüben geht stark zurück, die Rübenkörper bleiben aber fest. Das Laub wird gelb, verwelkt aber nicht nennenswert. Laborergebnisse lassen vermuten, dass erst das massive Auftreten des Stolbur-Erregers zu den derzeit teilweise dramatischen Schadbildern mit welken "Gummirüben" in Zuckerrüben-Schlägen geführt hat.
Der Thüringer Bauernverband beobachtet die Situation weiterhin sehr genau und tauscht sich eng mit den entsprechenden Stellen aus.
Mehr dazu gibt es auf der Seite des Julius-Kühn-Institut.
Achtung Abzocke! Betrügerische Telefonanrufe der SEO Medien GmbH und ABVZ
Nadja Gipser Donnerstag, 19. Juni 2025Unter dem Vorwand einer Umfrage zum Thema „Google Maps-Standortabfrage“ ruft derzeit die SEO Medien GmbH Landwirte und landwirtschaftliche Unternehmen an. Ein solches Gespräch endet dann mit einer Rechnung über mehrere Tausend Euro.
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Befall von ÖR1a-Flächen mit Giftpflanzen: Neue Verfahrensweise für eine zulässige Bekämpfung bei Wahrung des Prämienanspruchs
Anja Nußbaum Donnerstag, 19. Juni 2025Aufgrund von Nachfragen und geäußerter Unsicherheit aus der Mitgliedschaft haben wir Anfang Mai beim Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TMWLLR) zur Bekämpfung von invasiven Arten (insbesondere dem Orientalischen Zackenschötchen) ohne Verlust der Flächenförderung nachgefragt.
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Zweijährige Nachweisführung der Kennarten stellt derzeit keine Erleichterung dar
Anja Nußbaum Mittwoch, 18. Juni 2025In unserem Wochenbericht von Anfang April berichteten wir, dass der Thüringer Bauernverband (TBV) zum Arbeitsgruppentreffen Bürokratieabbau weniger Nachweispflichten gefordert hat. Dabei ging es insbesondere um die Nachweisführung zu den vier Kennarten im Rahmen der Ökoregelung 5, aber auch zu den 6 bzw. 8 Kennarten im Rahmen der KULAP-Maßnahmen. Hintergrund für die Forderung nur noch alle zwei Jahre einen Nachweis zu erbringen,
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Feldtag im Landkreis Nordhausen: Sortenversuche der Agrar GmbH Mauderode-Herreden
Susann Goldhammer Montag, 16. Juni 2025Nun schon zur guten Tradition geworden, treffen sich die Nordhäuser Landwirte jährlich zu einem Feldtag, um den Sortenversuch im Winterweizen und Raps der Agrar GmbH Mauderode-Herreden zu begutachten. In diesem Jahr war es am vergangenen Freitag (13. Juni) wieder soweit - bei schönstem Sonnenschein.
Eingeladen hatten die Südharzer Landhandel GmbH Nordhausen und der Kreisbauernverband Nordhausen. Fast 40 Landwirte waren gekommen, um die 21 Sorten Weizen auf einer Schlaggröße von ca. 57 ha und die 9 Sorten Raps, die auf einer Schlaggröße von ca. 150 ha angelegt worden sind, "unter die Lupe“ zu nehmen und in einen regen Austausch mit den jeweiligen Vertriebsberatern zutreten.
Eine Rundumversorgung mit Thüringer Rostbratwurst und reichlich kühle Getränke am Feldrand, rundeten den informativen Vormittag ab. So ein Feldtag ist immer eine gute Gelegenheit sich nochmal kurz vor der Ernte zu treffen und sich auszutauschen.
Vielen Dank an die Agrar GmbH Mauderode-Herreden und an die einzelnen Vertriebsberater sowie an alle fleißigen Helfer.
Die Landvolkbildung Thüringen (LVB) bietet am 24. Juni 2025 im Diakonie Landgut Holzdorf/ Weimar eine Schulung für landwirtschaftliche Berater an. Diese richtet sich an Berater, die bereits ELER-geförderte Beratungen in Thüringen durchführen.
Die Schulung setzt sich aus verschiedenen Fachvorträgen zusammen. Das Thema der Veranstaltung lautet: „Vorstellung der eigenen Arbeitsschwerpunkte in der landwirtschaftlichen Fachberatung“.
Im Rahmen dieser landwirtschaftlichen Fortbildungsveranstaltung in Thüringen werden den Teilnehmenden verschiedene Aspekte der modernen Landwirtschaft nähergebracht. Der Vormittag beginnt mit einem Vortrag über die fachgerechte Nutzung und den sicheren Umgang mit der FAN-App in Thüringen. Diese App soll den Landwirten helfen, ihre Arbeit effizienter zu gestalten und wichtige Informationen schnell und einfach abzurufen.
Im Anschluss wird das AKIS-Programm vorgestellt. Ein weiterer Vortrag befasst sich mit der monatlichen Betriebszweigauswertung von Milch, Wirtschaftlichkeit und Investitionen. Hierbei werden auch die Barwert- und Kapitalwertmethode erläutert.
Nach dem Mittagessen folgen weitere interessante Vorträge. Ein Highlight wird der Vortrag über Biosicherheit und Managementplänen in Betrieben sein. Dabei geht es um die Auswertung von Leistungsdaten, Tiergesundheit und den Umgang mit verletzten Tieren. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Tipps und Hinweise, wie die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere verbessert werden kann.
Ein weiterer Vortrag befasst sich mit dem Projekt "StripTill-Kooperation Thüringen - Den Boden im Blick". Hierbei werden die Bedeutung von nachhaltiger Bodenbearbeitung und die Vorteile von StripTill-Verfahren erläutert. Abschließend wird die Darstellung von Parametern in der Planung und Koordination von Agroforstsystemen vorgestellt. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in die Möglichkeiten, wie Betriebe durch die Kombination von Landwirtschaft und Forstwirtschaft diversifizieren und somit langfristig erfolgreich gestalten können.
Die Veranstaltung bietet eine gute Gelegenheit für die Fachberater, sich über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Landwirtschaft zu informieren und sich miteinander auszutauschen.
Anmeldung oder Fragen richten Sie an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Weitere Informationen und den Flyer zur Veranstaltung finden Sie hier.
Verleihung der Goldenen Ehrennadel des TBV an Ingolf Lerch
TBV/ Andreas Fernekorn Montag, 16. Juni 2025Anlässlich seines 60. Geburtstages am 14. Juni wurde Ingolf Lerch, langjähriger Vorsitzender des Eichsfelder Bauernverbandes e.V., mit der Goldenen Ehrennadel des Thüringer Bauernverbandes (TBV) ausgezeichnet. Die Ehrung nahm TBV-Präsident Dr. Klaus Wagner persönlich vor.
In seiner Laudatio würdigte Wagner die langjährigen Verdienste Lerchs um den Berufsstand – sowohl auf Kreis- als auch auf Landesebene. Lerch verstehe es, so Wagner, „die Anliegen der Landwirte mit Beharrlichkeit, Ruhe, Sachlichkeit und hoher Kompetenz zu vertreten“.
Nach dem Agrarstudium an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg war Ingolf Lerch zunächst in der Verwaltung tätig, zuletzt als Abteilungsleiter für Pflanzenproduktion im Landwirtschaftsamt Leinefelde. Seit 1998 ist er Vorstandsvorsitzender der Lever Agrar AG Heiligenstadt.
Im Ehrenamt übernahm er 2003 den Vorsitz des Kreisverbandes Eichsfeld, ist seit 2009 Vorsitzender des TBV-Fachausschusses Agrarrecht sowie Leiter der Mandatsprüfungskommission.
Als engagierter Ehrenamtler prägte er u. a. den überregional bekannten Eichsfelder Bauernmarkt in Kallmerode, das Erntedankfest der Landsenioren im Altkreis Heiligenstadt und ist im Vorstand der RAG Leader des Eichsfeldkreises .
Das Präsidium des TBV folgte dem Vorschlag des Kreisvorstandes Eichsfeld und zeichnete Ingolf Lerch für seine herausragende Arbeit mit der höchsten Auszeichnung des Verbandes aus.
Der Eichsfelder Bauernverband und der TBV wünschen alles Gute zum 60. Geburtstag und ein herzliches Dankeschön für Dein Engagement, lieber Ingolf!
Ertragsschadenversicherung: Ein Muss für die moderne Tierhaltung
Michael König Donnerstag, 12. Juni 2025In diesem Jahr sind zeitweise fünf verschiedene Tierseuchen gleichzeitig aufgetreten: Blauzungenkrankheit, Afrikanische Schweinepest, Geflügelpest, Bovines Herpesvirus Typ 1 und Maul- und Klauenseuche. Ein äußerst seltenes Ereignis, das landwirtschaftliche Tierhalter vor große Herausforderungen stellt.
Ob Rind, Schwein oder Geflügel: Durch behördliche Anordnung können Tierseuchen und Krankheiten ganze Betriebe lahmlegen – selbst, wenn sie nicht direkt betroffen sind, sondern nur im Sperrbezirk liegen. Gegen die verheerenden Einnahmeverluste und Folgeschäden schützt die Ertragsschadenversicherung der R+V.
Ertragsschadenversicherungen sind speziell für tierhaltende landwirtschaftliche Betriebe konzipiert. Sie bieten Schutz vor finanziellen Einbußen, die durch unerwartete Krankheitsausbrüche oder Seuchen verursacht werden. Im Gegensatz zur Tierseuchenkasse, die in der Regel nur bei der Tötung von Tieren einspringt, leisten Ertragsschadenversicherungen beispielsweise bereits bei einem krankheitsbedingten Rückgang der biologischen Leistungen.
Beispiele aus der Landwirtschaft
Rinderhaltung: Bei einem Ausbruch von Tierseuchen wie BTV3, BHV1, Rindertuberkulose oder einer übertragbaren Tierkrankheiten (z. B. Mastitis) kann eine gesamte Herde betroffen sein. Die Ertragsschadenversicherung kommt für die finanziellen Verluste auf, die beispielsweise durch verminderte Milchproduktion entstehen können.
In der Schweinehaltung kann der Ausbruch von Klassischer oder Afrikanischer Schweinepest zur Sperrung von Beständen führen. Dies hat nicht nur gesundheitliche, sondern auch wirtschaftliche Schäden zur Folge, da die Tiere nicht verkauft werden können und es zu Produktionsausfällen kommt. In solchen Fällen springt die Ertragsschadenversicherung ein und entschädigt die Schweinehalter für Mindereinnahmen und Mehrkosten.
Geflügelhaltung: Eine Vogelgrippe kann schnell zu hohen wirtschaftlichen Verlusten führen. Die Keulung ganzer Bestände sind keine Seltenheit. Dies hat einen direkten Einfluss auf die Einnahmen des Betriebs. Mit einer Ertragsschadenversicherung erhalten die Landwirte Unterstützung bei der Kompensation finanzieller Einbußen.
Die Ertragsschadenversicherung sichert Sie gegen finanzielle Verluste ab, die durch Schäden im Tierbestand entstehen können. Sie bietet Ihnen finanziellen Rückhalt und trägt dazu bei, die Stabilität und Liquidität Ihres Betriebes sicherzustellen.
Wir wissen, dass jeder landwirtschaftliche Betrieb einzigartige Bedürfnisse und Risikofaktoren hat. Angesichts steigender Risiken durch Tierseuchen und Tierkrankheiten ist es für Landwirte unerlässlich, sich über diese Absicherungsmöglichkeiten zu informieren und die passende Versicherung für ihren Betrieb auszuwählen. Daher setzen wir auf eine Beratung, die individuell auf Sie und Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Durch gezielte Absicherungen und präventive Maßnahmen helfen wir Ihnen, ihre Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.
Falls Sie weitere Informationen zu diesem Thema suchen, kontaktieren Sie hierzu Ihren Berater Jens Gießler per E-Mail unter vDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter +49 361 262 53 801.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.ruv.de - unter Firmenkunden – Landwirtschaft – Ertragsschadenversicherung.
Sie sind bereits Kunde der R+V Versicherung und haben eine Ertragsschadenversicherung? Dann besteht jetzt eventuell Handlungsbedarf, die zugrundeliegenden Parameter zu überprüfen. Die Volatilität der Agrarmärkte hat in den letzten Jahren zugenommen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin und aktualisieren Sie gemeinsam mit unseren Beraterinnen/ Beratern ggf. Ihre Tierzahlen und/ oder die Marktpreise.
DBV kritisiert so genannte „Erntegut-Bescheinigungen“: Irritationen durch unverhältnismäßige Forderungen
DBV Donnerstag, 12. Juni 2025Der Deutsche Bauernverband (DBV) kritisiert das Vorgehen der Saatgut-Treuhand-verwaltungs GmbH (STV), die unverändert den Agrarhandel und damit auch Landwirte mit überzogenen und übergriffigen Abmahnungen unter Druck zu setzen versucht und in das so genannte Erntegut-System der STV zwingen will. „Dieses Geschäftsgebaren der STV diskreditiert die Erzählung von der mittelständischen Pflanzenzüchtung, die für sich eine besondere Schutzbedürftigkeit beansprucht“, so DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken. „Inakzeptabel ist vor allem, dass denjenigen Landwirten, die ordnungsgemäßen Nachbau betreiben oder Z-Saatgut einsetzen, bürokratische und datenschutzrechtlich fragwürdige Prozeduren aufgezwungen werden sollen. “
Dies führe dazu, dass mehrerer Agrarhändler offenbar unter Druck der STV unverhältnismäßige Forderungen an die Landwirtschaft stellen und den Eindruck erwecken, dass zur Erfüllung des BGH-Urteils zum Erntegut nur noch die Erntegutbescheinigungen der Saatgut-Treuhand STV zulässig seien. Aus Sicht des DBV hat der Bundesgerichtshof im so genannten Erntegut-Urteil lediglich eine allgemeine Erkundigungspflicht des Handels festgestellt, jedoch keinerlei Vorgaben zur konkreten Ausgestaltung gemacht. Eine rechtliche Verpflichtung zur Nutzung der STV-Erntegutbescheinigung ist daraus nicht abzuleiten. Das BGH-Urteil werde hier bewusst falsch interpretiert und als Druckmittel gegen die Landwirte missbraucht. Zur Erfüllung der Erkundigungspflicht reicht auch eine einfache Selbsterklärung des Landwirtes aus. Geschäfts- und Lieferbedingungen des Agrarhandels, bei denen Abrechnung und Zahlung gelieferter Ware an die Vorlage einer STV-Bescheinigung gebunden wird, sind nicht durch das Erntegut-Urteil gedeckt und als problematisch zu bewerten. Landwirte sollten kritisch überprüfen, ob sie eine solche einseitige Benachteiligung in der Lieferbeziehung akzeptieren können.
Der DBV zeigt grundsätzliches Verständnis für die schwierige Lage, in der sich Agrarhändler durch das Vorgehen der Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft STV befinden. „Wir verstehen, dass auch die Händler Rechtssicherheit benötigen", so Krüsken. „Dennoch können wir nicht akzeptieren, dass überzogene Rechtsauslegungen durch die Kette weitergegeben und einseitig zu Lasten unserer Landwirte ausgetragen werden.“ Nach ersten Einschätzungen des DBV sind diese Methoden außerdem kartell- und wettbewerbsrechtlich fragwürdig. Allgemeine Geschäftsbedingungen dürfen den Vertragspartner nicht unangemessen benachteiligen – auch nicht zwischen Unternehmern. Der Deutsche Bauernverband fordert daher die sofortige Einstellung der irreführenden Kommunikation zu angeblich rechtlichen Verpflichtungen und appelliert an die Agrarhändler, zu einem fairen und transparenten Umgang mit ihren landwirtschaftlichen Partnern zurückzukehren.
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Am 3. Juni fand im Landratsamt Sondershausen die diesjährige Landwirtschaftskonferenz statt. Organisiert wurde die Veranstaltung gemeinsam vom Landratsamt des Kyffhäuserkreises und dem Bauernverband Kyffhäuserkreis. Ziel des Treffens war es, aktuelle Themen der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes zu diskutieren und gemeinsame Lösungsansätze zu finden. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Landwirtschaft kamen miteinander ins Gespräch – auf Augenhöhe.
Vertrauen statt Verdacht
Kreisvorsitzender Dr. Wolfgang Peter eröffnete die Konferenz mit einem deutlichen Appell an die Politik: Es brauche endlich einen spürbaren Bürokratieabbau. Die Landwirte verbringen immer mehr Zeit mit Formularen, Dokumentationen und digitalen Eingabemasken – auf Kosten der eigentlichen landwirtschaftlichen Arbeit. Diese Entwicklung sorgt seit Jahren für wachsenden Frust in den Betrieben. Er forderte daher von der Landesregierung weitere wirksame Maßnahmen zum Bürokratieabbau in der Landwirtschaft. Überbordende Anforderungen müssten entschlackt und zusammengeführt werden. Digitale Lösungen müssten tatsächliche Erleichterungen bringen und vollständig funktionieren – statt zusätzliche Fehlerquellen und Bürokratielasten zu schaffen. Kontrollen sollten risikoorientiert und anlassbezogen erfolgen. Landwirte brauchen Spielräume, nicht Gängelung und Kontrollwahn.
„Vertrauen statt Verdacht muss das neue Leitmotiv sein“, betonte er und forderte, dass sich die Landesregierung auf allen Ebenen konsequent für einen Bürokratieabbau einsetzen solle.
Die Bauernproteste im vergangenen Jahr hätten deutlich gemacht, wie groß der Unmut über diese Entwicklungen sei – und wie dringend sich etwas ändern müsse. Peter hob aber auch hervor, dass bereits einige Erleichterungen für die Landwirtschaft erreicht worden seien, darunter:
- die Aufhebung der 4-prozentigen Flächenstilllegung,
- die Wiedereinführung der Drittelfinanzierung bei der Tierkörperbeseitigung durch das Land,
- die Rücknahme des geplanten Thüringer Agrar- und Forststrukturgesetzes,
- Fortschritte bei der Düngeregelung auf gefrorenen Böden sowie
- Initiativen zur Stoffstrombilanz und beim Flächenregister.
Auch die angekündigte Wiederaufnahme der Agrardieselförderung wurde von ihm als wichtiger politischer Schritt gewertet.
Vieles dauere in der Politik sehr lange, bis es endlich zur praktischen Umsetzung komme. Ist ein Thema geklärt, stünden bereits die nächsten Probleme an. Die verbandliche Arbeit sei daher ständig gefordert. Positiv stellte er abschließend fest, dass in Gesellschaft und Politik das Thema Ernährungssicherheit und Selbstversorgung wieder eine größere Rolle einnehme.
Ländlichen Raum stärken
Landrätin Antje Hochwind-Schneider schloss sich der Kritik an. Die Bürokratie sei inzwischen so komplex, dass die Verwaltung selbst an ihre Grenzen stoße. Ziel müsse es sein, mehr Eigenverantwortung zu ermöglichen, statt alles mit Nachweisen belegen zu müssen. Politik und Verwaltung müssten sich die Frage stellen: „Wie kann man notwendige Sachverhalte auch unkompliziert regeln?“
Die Landrätin wies zudem auf strukturelle Probleme im ländlichen Raum hin: Wohnungsleerstand, ein schwacher öffentlicher Nahverkehr und abnehmende Versorgung stellen viele Regionen vor große Herausforderungen. „Wenn sich dieser Trend fortsetzt, droht in den Städten durch den dortigen Zuzug und mangelnden Wohnraum ein Kollaps, während der ländliche Raum weiter ausblutet“, warnte sie eindringlich. Es gelte, neue Perspektiven zu schaffen und den ländlichen Raum wieder attraktiver zu gestalten.
Politik muss anpacken
Staatssekretär Marcus Malsch vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum betonte in seinem Redebeitrag die Notwendigkeit einer politischen Neuausrichtung. „Wir müssen an die Wurzel ran, Strukturen hinterfragen und verbessern. Bürokratie muss auf das Notwendigste beschränkt werden.“
„Miteinander reden – Problem verstehen – Problem lösen“, so seine Vorstellung. „Die Behördenmitarbeiter sind Dienstleister, und der Bürger bzw. Landwirt ist der Kunde – dorthin müssen wir wieder zurückfinden. Die Mitarbeiter in den Behörden brauchen zudem den Rücken frei für gute Entscheidungen“, so Malsch. Als besonders wichtig sieht er den engen Austausch mit der landwirtschaftlichen Praxis.
Im Verhältnis zum Umweltministerium sei man nicht ideologisch unterwegs, sondern arbeite eng an pragmatischen, guten Lösungen. Sehr positiv bewertete er die Bauernproteste. Hier sei deutlich geworden, dass die Landwirtschaft die Unterstützung der Gesellschaft habe. „Wenn du auf den Bauern hörst, geht’s dir gut“, zitierte er treffend.
Große Herausforderungen beim Naturschutz
Dr. Hans-Jürgen Schäfer, Abteilungsleiter für Naturschutz und Nachhaltigkeit im Thüringer Umweltministerium, sprach unter anderem zum Thema Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, z. B. bei der Errichtung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Die geplante Novelle der Kompensationsverordnung müsse praxistauglicher werden – insbesondere im Hinblick auf den Flächenverbrauch, so auch die Forderung des Berufsstandes.
Auch das Thema Wolf wurde diskutiert. Für Thüringen sei nach seiner Einschätzung der „günstige Erhaltungszustand“ erreicht. Die Frage, wie viele Wölfe das Land verträgt, solle bald bundeseinheitlich geklärt werden. Beim Thema Biber, deren Population im Freistaat Bayern bereits seit Jahren außerordentlich zugenommen hat, sodass regional erhebliche Schäden festzustellen sind, kam es bereits zu Entnahmen einzelner Tiere. Damit Thüringen hier von solchen Problemen verschont bleibt, kündigte er einen entsprechenden Managementplan mit abgestimmten Präventions-, Förder-, Entschädigungs- und Ausgleichsmöglichkeiten an.
Als besonders große Herausforderung bezeichnete er die Umsetzung der neuen EU-Naturwiederherstellungsrichtlinie – sowohl finanziell als auch zeitlich.
Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur soll Schäden an der europäischen Natur bis 2050 beheben. Die Richtlinie legt EU-weit rechtlich verbindliche Ziele für die Wiederherstellung der Natur in verschiedenen Ökosystemen vor. Bis 2030 sind auf mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresflächen der EU, Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur durchzuführen. Ebenfalls bis 2030 sind alle natürlichen und naturnahen Ökosysteme auf dem Weg der Erholung zu bringen und bis 2050 sollen 100 Prozent der schützenswerten Ökosysteme an Land und 90 Prozent der Meere in einen guten ökologischen Zustand gebracht werden. Im laufendem Finanzrahmen stehen rund 100 Milliarden Euro für biologische Vielfalt zur Verfügung - darunter auch für Renaturierungsmaßnahmen.
Die Landwirtschaftskonferenz 2025 zeigte den angekündigten neuen Politikstil der Brombeer-Koalition: Politik, Verwaltung und Landwirtschaft suchen gemeinsam nach Lösungen. Der Austausch auf Augenhöhe wurde von allen Beteiligten sehr positiv bewertet. Während der Diskussionsrunde wurden weitere Themen und Beispiele besprochen, die nicht alle beantwortet werden konnten, aber im Nachgang schriftlich geklärt werden sollen.
Am Freitag, den 27. Juni findet der Digitaltag 2025 statt. Im Rahmen einer einstündigen Online-Veranstaltung ab 12:30 Uhr lädt der Deutsche Bauernverband (DBV) dazu alle Landwirtinnen, Landwirte und Interessierten ein, sich über das Thema „Cybersecurity Check auf dem Hof – So schützen Sie Ihren Betrieb vor digitalen Bedrohungen“ zu informieren.
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Der Regionalbauernverband Südthüringen führt seit vielen Jahren in seinen drei Landkreisen Flurfahrten durch, um den Austausch von Landwirten aus der Region mit Landräten und Ämtern auf Augenhöhe zu fördern.
Den Auftakt für diese zur Tradition gewordene Veranstaltung machte der Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Ziel hier war das LVV Ökozentrum Werratal in Vachdorf. Andreas Baumann, Geschäftsführer LVV Ökozentrum Werratal, begrüßte zusammen mit der Kreisbauerverbandsvorsitzenden Isabell Schmidt die zahlreichen Gäste bevor es auf den Krayenberg, einem Aussichts- und Tourenpunkt auf dem Kelten-Erlebnisweg ging. Hier präsentierte Baumann zusammen mit dem Landschaftspflegeverband ein Projekt zur Pflege eines Hanges durch Beweidung. Baumann lobte die enge konstruktive Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband, erläuterte aber auch Schwierigkeiten, wie z.B die immer wieder auftretende Zerstörung der Weidezäune für die Ziegen am Hang.
Zurück auf dem Betriebsgelände legte Baumann die Herausforderungen im Ökolandbau dar und wies auf einige Probleme hin, die auch alle anderen Landwirte betreffen. Die TA-Luft und ihre teilweise unsinnigen Vorgaben waren Teil der Diskussion. Frau Wenzel von der Unteren Immissionsschutzbehörde wies hier auf Ermessensspielräume der Mitarbeiter hin und erklärte Gesprächsbereitschaft, wenn Betriebe Probleme signalisierten.
Weiterhin wurden die Auslegungen zum Weidegang des Milchviehs diskutiert und die damit verbundenen Schwierigkeiten.
Die Kreisjägerschaft Meiningen war mit dem Thema "Kitzrettung" vor Ort und erläuterte die enge und äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Landwirten in diesem Jahr.
Die Landrätin Peggy Greiser war wieder äußerst interessiert an den Problemen und Herausforderungen der Landwirte und bot wie immer ihre Hilfe und Zusammenarbeit an.
Laut Informationen des Deutschen Bauernverbandes (DBV) aus Brüssel will die EU-Kommission zum 16. und 23. Juli 2025 laut aktuellem Stand ihre Pläne für den Mehrjährigen Finanzrahmen 2028-2034 (MFR) vorlegen. Hierbei ist wohl auch im Gespräch, zeitgleich die Pläne für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2027 vorzustellen. Auf Brüsseler Ebene wurde laut DBV auch klar, dass viele Akteure u.a. einen erhöhten Druck auf die Kohäsionspolitik erwarten. Diese soll zu gleichwertigen Lebensverhältnissen beitragen, was auch dem ländlichen Raum z.B. mit Infrastrukturprojekten nützt. Hier sehen viele Beobachter die Gefahr, dass dieses Geld fokussierter in Richtung von Städten und Industriezentren eingesetzt wird, anstatt es in die Breite zu investieren. Auch für das „LEADER-Programm“, was über die 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik finanziert wird, werden Kürzungen oder sogar komplette Streichungen erwartet. Je nach Bundesland hat dies unterschiedliche Auswirkungen, da dieses Instrument je nach Bundesland unterschiedlich stark genutzt wird. Der Druck zum Sparen kommt wohl aus der Not heraus, die Coronahilfen der Vergangenheit zu tilgen und auch dem Anspruch, mehr für die Verteidigung ausgeben zu wollen, gerecht zu werden. Klar bleibt, der DBV fordert weiter einen eigenen und starken EU-Agrarhaushalt. Deshalb gilt es neben möglichen Details zur nächsten GAP insbesondere das nötige Budget zu sichern.
Umstufung des Wolfes in FFH-Richtlinie endgültig beschlossen
Olivia Meyer/ DBV Sonntag, 08. Juni 2025Nachdem sich das Europäischen Parlament bereits für eine Änderung der FFH-Richtlinie zum Schutzstatus des Wolfes ausgesprochen hat, wurde diese am 5. Juni nun auch vom Europäischen Rat endgültig beschlossen. Im Ergebnis wird der Schutzstatus des Wolfes auf EU-Ebene offiziell
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Zum 2. Juni hat die Thüringer Aufbaubank die Informationen zur ILU Investitionsförderung überarbeitet. Dabei wurden die Stichtage zur Einreichung von Förderanträgen 2025/2026 aktualisiert. Aufgrund des Antragsvolumens zum ersten Stichtag 2025 und damit freien Budgets wird ein weiterer Stichtag in 2025 für Teil D angeboten. Antragsstichtag ILU 2023
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Innovation trifft Landwirtschaft: Investor Days Thüringen 2025
Celine Stieger Donnerstag, 05. Juni 2025Am 5. Juni fanden die „Investor Days Thüringen“ in der historischen Peterskirche in Erfurt statt. Die Veranstaltung bot eine Plattform für Gründerfirmen, ihre innovativen Geschäftsmodelle vorzustellen und sich mit Investoren und Branchenexperten zu vernetzen. Vertreten waren Unternehmer, Entwickler und Fachleute aus den Bereichen Gesundheit, Entwicklung nachhaltiger Materialien und Landwirtschaft.
Der Thüringer Bauernverband (TBV) war als Branchenvertreter und Netzwerkpartner vor Ort und konnte Kontakt zu einem aufstrebenden Unternehmen im Bereich der digitalen Agronomie knüpfen: Pheno-Inspect. Vorgestellt wurde das Unternehmen von Dr. Philipp Lottes, der demonstrierte, wie agronomische Entscheidungen künftig auf der Grundlage unabhängiger Datenauswertung getroffen werden können. Die Basis dieser Innovation ist ein KI-gestütztes Bildanalysesystem, das mithilfe von Drohnen Luftbilder von Anbauflächen erstellt und diese automatisch auswertet. Mögliche Anwendungsbereiche sind bisher die Erkennung von Unkraut-Hotspots, Biomasseschätzungen, Bestimmungen der Blütestadien und der Analyse von Stressindikatoren.
Dank der stetig sinkenden Anschaffungskosten für Drohnen ermöglicht die Lösung eine schnelle, datenbasierte Entscheidungsfindung bei niedrigen Betriebskosten.
Aktuell arbeitet Pheno-Inspect an einer benutzerfreundlichen und intuitiv bedienbaren Oberfläche. Der Einsatz auf Testbetrieben ist für das Jahr 2026 geplant. Das Unternehmen wird sich auf der diesjährigen Agritechnica präsentieren.
Betriebe, die Interesse an einer Teilnahme als Testbetrieb haben, können sich beim TBV unter Tel.: +49 (0)361 262 532 06 melden.
Positive Rückmeldungen gab es von den Veranstaltern über die Präsenz des TBV. Sie bestätigten den Bedarf, innovative Agrartechnologien aktiv in die Praxis einzubringen und gemeinsam mit regionalen Partnern weiterzuentwickeln.
Stalleinbrüche: DBV veröffentlicht Handlungsempfehlungen für betroffene Tierhalter
TBV/ DBV Mittwoch, 04. Juni 2025Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat eine aktualisierte Version des Ratgebers Stalleinbrüche - Handlungsempfehlungen für betroffene Tierhalter veröffenlicht.
Mit diesem Faktencheck informiert der DBV betroffene Landwirte über den Umgang mit Stalleinbrüchen, Möglichkeiten zur Vorbeugung, über die juristische Bewertung des widerrechtlichen Eindringens in Ställe und der Veröffentlichung hierbei erlangter Bild- und Videomaterialien sowie
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Einführung der RED III: Aktualisierte SURE-Systemdokumente verfügbar
Hauptstadtbüro Bioenergie Dienstag, 03. Juni 2025Zum 2. Juni nimmt Beate Köber-Fleck ihre Tätigkeit als Hauptgeschäftsführerin des Thüringer Bauernverbandes (TBV) auf.
Beate Köber-Fleck ist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und hat ihr Bachelor- und Masterstudium der Agrarwissenschaften in Hohenheim erfolgreich abgeschlossen. Sie bringt somit fundierte fachliche Kompetenzen sowie eine tief verwurzelte und persönliche Verbindung zur Landwirtschaft mit.
Beruflich arbeitete sie bisher in Führungspositionen in der Agrartechnik und Müllerei. Zuletzt war sie als Leiterin Vertrieb Ost und Standortkoordinatorin bei der Roland Mills United GmbH & Co. KG in Bad Langensalza tätig. Zuvor arbeitete sie mehrere Jahre bei der CLAAS KGaA mbH unter anderem in leitenden Positionen im Projektmanagement, der Produktstrategie und der Unternehmensentwicklung.
Mit ihrer vielfältigen Expertise ist Beate Köber-Fleck gut aufgestellt, um die Interessen der Thüringer Landwirte zu vertreten und den Verband gemeinsam mit dem Ehrenamt sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern strategisch weiterzuentwickeln.
+++ Umfrage zur Funktionalität von PORTIA +++ Bitte um Teilnahme!
Anja Nußbaum Montag, 02. Juni 2025Vor drei Jahren wurde die Sammelantragstellung auf das rein onlinebasierte System im Portal PORTIA und Authentifizierung mit dem Personalausweis in Thüringen eingeführt. Viele Mitglieder haben sich beim Thüringer Bauernverband (TBV) zum Umgang mit dem Portal gemeldet. Fehlermeldungen oder Änderungswünsche hat der TBV in der Arbeitsgruppe (AG) Antragstellung und Kontrollen oder auch im bilateralen Gespräch mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum direkt ansprechen können. Viele Probleme und Startschwierigkeiten wurden mittlerweile abgestellt.
Herausforderungen und der Wunsch nach notwendigen Instrumenten bestehen aber nach wie vor. Grund genug mit einer kleinen Umfrage zum Portal PORTIA den aktuellen Stand abzufragen. Die Antworten dienen unter anderem, um in der AG Antragstellung und Kontrollen die Themen besser zu platzieren, zu diskutieren sowie eine verbesserte Funktionalität einzufordern.
Wir bitten um zahlreiche Teilnahme an der Umfrage bis zum 30. Juni 2025!
+++Hier geht es zur Umfrage+++
Rücksendung bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Die Frist für die Umsetzung des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes (THKG) soll vom 1. August 2025 auf den 1. März 2026 verschoben werden. Darauf haben sich am 22. Mai Agrarpolitiker der Union und SPD in Berlin verständigt. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen wurde bereits am
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Ergebnisse für die Landwirtschaft aus dem Koalitionsausschuss
DBV/ Katja Förster Freitag, 30. Mai 2025Am vergangenen Mittwoch (28. Mai) fand ein Koalitionsausschuss statt. Union und SPD haben dabei ein Sofortprogramm angekündigt, das zahlreiche Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag enthält und bis Mitte 2026 umgesetzt werden soll.
Der Deutsche Bauernverband (DBV) begrüßte die Ergebnisse. "Die Richtung stimmt", erklärte DBV-Präsident Joachim Rukwied dazu.
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Der Fachausschuss (FA) Ökologischer Landbau des Deutschen Bauernverbandes (DBV) kam am Freitag (23. Mai) zu einer Online-Sondersitzung „Öko-Tierhaltungsregeln“ zusammen. Tagesordnungspunkte waren die Lobby-Aktivitäten zur Verhinderung einer alternativlosen Öko-Weidepflicht für das Milchvieh (Kühe, Ziegen, Schafe). Es wurde über die Alternativen zur Weidepflicht für Öko-Wiederkäuer, insbesondere Milchvieh und Nachzucht berichtet. Der DBV und der Bayrische Bauernverband kooperieren zu dem Thema seit Februar eng mit Naturland in Form von Briefen an Kommissar Hansen sowie an die Landwirtschaftsminister der Bundesländer. Für diese wurden Informationen zu den Hintergründen und alternative Möglichkeiten erstellt und die im Auftrag von Naturland erstellten Rechtsgutachten und Tierwohl-Gutachten beigefügt.
Intensiv wurde zuletzt auch mit den Österreichischen Verbänden kommuniziert. Weitere Entwicklungsblockaden in der Tierhaltung durch das EU-Öko-Tierhaltungsrecht, wie der überflüssige Pflicht-Grünauslauf für Junggeflügel in der ersten Voraufzuchtphase ab 2030 wurden ebenfalls beraten. Der DBV-FA Ökolandbau vereinbarte in den nächsten Jahren eine Gesamtstrategie für eine fachgerechte und tierwohlgerechte Öko-Tiergesetzgebung Richtung der deutschen Bundesländer und vor allem der EU-Kommission, zu verfolgen.
Vorstandssitzung mit Betriebsleitern vom KBV Nordhausen und BV Kyffhäuserkreis
Susann Goldhammer Montag, 26. Mai 2025Einmal im Jahr findet beim Kreisbauernverband (KBV) Nordhausen die nun schon zur guten Tradition gewordene erweiterte Vorstandssitzung, zu der auch die Betriebsleiter der Mitgliedsunternehmen eingeladen werden, statt. Diesmal war es am 21. Mai in Günzerode wieder soweit und hierzu waren erstmalig auch die Mitgliedsbetriebe aus dem benachbarten Bauernverband (BV) Kyffhäuserkreis eingeladen, da die Themen von allgemeinem Interesse waren.
Nadja Gipser, Referentin des Thüringer Bauernverbandes, informierte über die rechtlichen Grundlagen sowie über Unterschiede von landwirtschaftlichen u. nichtlandwirtschaftlichen Transporten und was hierbei zu beachten ist.
Von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) Kassel wurde Hartmut Fanck begrüßt. Er referierte zur Beitragsanpassung bzw. Umstellung der Landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK).
Auch die Kreissparkasse (KSK) Nordhausen möchte in Zukunft Partner für die Landwirtschaftsbetriebe sein. Jan Oberbüchler, Vorstandsmitglied der KSK, gab hierzu Auskünfte bzgl. möglicher Finanzierungsmöglichkeiten.
Am 20./21. Mai haben sich die Sozialreferenten der Landesbauernverbände und des Deutschen Bauernverbandes (DBV) zu einer Tagung in Erfurt getroffen.
Wesentliche Themen waren die Beiträge zur Landwirtschaftlichen Krankenversicherung und der Stand der Überprüfung der Standardeinkommenswerte im neuen Beitragssystem, die Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, insbesondere die Auswirkungen auf die Beiträge durch die geplante neue Berufskrankheit „Parkinsonsyndrom durch Pestizide“ sowie die Betriebs- und Haushaltshilfe. Hierzu gab es einen intensiven Austausch mit Referenten der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).
Behandelt wurden auch die Themen Sozialhilfeanspruch, Sozialhilferegress und Elternunterhalt, Herausforderungen bei Beschäftigung von Saisonkräften (Mindestlohn, 70-Tage-Regelung, Drittstaatsangehörige), geplante Maßnahmen der neuen Bundesregierung im Bereich Arbeit und Soziales sowie Vorhaben der neuen Arbeitsgruppe zur Suizidalität in der grünen Branche im Rahmen des Nationalen Suizidpräventionsprogramms für Deutschland (NaSPro).
Werden Sie Teil des bundesweiten Netzwerk „Leitbetriebe Pflanzenbau“!
André Rathgeber/ BLE Montag, 26. Mai 2025Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) startet eine Neuauflage des "Netzwerks Leitbetriebe Pflanzenbau". Rund 100 Betriebe unterschiedlicher Größe und aus allen Regionen Deutschlands können Teil des dreijährigen Netzwerks werden. Bewerbungen konventioneller und ökologischer Betriebe nimmt die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bis zum 31. Juli 2025 entgegen.
Bereits von 2021 bis 2025 nahmen rund 100 Betriebe aus ganz Deutschland am Projekt-Netzwerk teil. Damals wie heute ist es das Ziel, sowohl konventionell als auch ökologisch wirtschaftende Ackerbau- und Gemischtbetriebe deutschlandweit stärker zu vernetzen und die moderne, umwelt- und ressourcenschonende Landwirtschaft der Öffentlichkeit näherzubringen.
Ein Fokus liegt auf dem intensiven Wissensaustausch. Bei gegenseitigen Betriebsbesichtigungen lernen sich die Teilnehmenden "live" kennen und können vor Ort unterschiedliche Ansätze im Ackerbau erleben. Besonders produktiv war in der vergangenen Laufzeit ebenso die Online-Seminarreihe "Praxis-Talk". Hier stellen die Betriebe selbst praktikable und innovative Ansätze entlang der Handlungsfelder der Ackerbaustrategie 2035 vor. Diese diskutierten sie im Anschluss mit verschiedenen Expertinnen und Experten.
Teil des "Netzwerks Leitbetriebe Pflanzenbau" ist es, die lokale und regionale Öffentlichkeit auf die jeweiligen Höfe einzuladen. Dazu veranstalten die Netzwerkbetriebe beispielsweise Hoffeste oder Führungen für Schulklassen. Im direkten Austausch bringen die Landwirtinnen und Landwirte den Besuchern so den Ackerbau näher und schaffen mehr Transparenz und Verständnis.
Bei der Planung und Umsetzung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen erhalten die Netzwerkbetrieb fachkundige Hilfe in der Medienkommunikation und Veranstaltungsplanung. Eine Koordinationsstelle berät bei der Organisation von Terminen auf dem Betrieb, hilft in Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie bei der Produktion von Videos, Broschüren und weiterem Informationsmaterial. Zusätzlich können die Landwirte und Landwirtinnen auch an Fortbildungsmöglichkeiten zu Themen wie Pressearbeit, Pädagogik und Kommunikation teilnehmen.
Teilnahmebedingungen:
Betriebsleitende landwirtschaftlicher Betriebe können ihr Interesse an einer Zusammenarbeit im "Netzwerk Leitbetriebe Pflanzenbau" bis zum 31. Juli 2025 online bei der BLE bekunden. Informationen zur Bekanntmachung gibt es hier.
Hintergrund:
Mit dem Netzwerk Leitbetriebe Pflanzenbau setzt das BMLEH die Ackerbaustrategie 2035 konkret um. In der Ackerbaustrategie liegen die Schwerpunkte auf einer zukunftsorientierten und nachhaltigen, das heißt ökonomisch, ökologisch und sozial tragfähigen, Bewirtschaftung. Zum anderen geht es um die Versorgung der Gesellschaft mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, Futtermitteln und biogenen Rohstoffen.
TBV-Futterbörse für alle landwirtschaftlichen Betriebe in Thüringen: Angebote und Gesuche kostenlos einstellen!
André Rathgeber/ Maik Lange Montag, 26. Mai 2025Fehlende Niederschläge führen in weiten Teilen des Freistaates zu verminderten Aufwüchsen bei Wiesen und Weiden. Der Mais kommt nicht so richtig in Gang. Daher sehen einige Betriebe die Futterversorgung mit Sorge. Wir möchten daher auf unsere noch immer aktive Futterbörse des Thüringer Bauernverbandes hinweisen. Diese finden Sie hier oder unter www.tbv-erfurt.de unter Service-Leistungen > Futterbörse.
Sie haben Futtermittel abzugeben oder suchen für Ihre Tierhaltung Futter? Wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage gerne per E-Mail mit dem Betreff „Futterbörse“ an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Das Einstellen von Angeboten und Gesuchen ist kostenlos und ein Angebot für alle landwirtschaftlichen Betriebe in Thüringen!
Die Europäische Union stellt Deutschland eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 4,8 Millionen Euro zur Verfügung, um die wirtschaftlichen Folgen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche (MKS) Anfang des Jahres abzufedern. Die Hilfen richten sich insbesondere an
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Jetzt auf WhatsApp: Der Kanal des Thüringer Bauernverbandes e.V. zum Abonnieren!
TBV Sonntag, 25. Mai 2025🆕 Jetzt auf WhatsApp: Der Kanal des Thüringer Bauernverbandes e.V.!
Hier erhaltet ihr Informationen rund um die Landwirtschaft - Themen, die bewegen: 🧑⚖️ Agrarpolitik & Verbandsarbeit – Einschätzungen, Positionen & Beschlüsse 🌍 Berichte aus Kreisbauernverbänden & Regionen 📢 Stimmen aus der Praxis 📈 Förderungen & Programme – Was läuft, was kommt, was hilft 🌾 Entwicklungen, Ausblicke, Einschätzungen 📅 Veranstaltungen & Termine – Messen, Demos, Fachtreffen
Aktuell. Kompakt. Direkt aufs Handy.
Ab sofort erhaltet ihr die Informationen des Thüringer Bauernverbandes e.V. direkt bequem über WhatsApp! Bleibt immer auf dem Laufenden über agrarpolitische Entwicklungen, Verbandsaktivitäten und wichtige Termine rund um die Thüringer Landwirtschaft.
Und so funktioniert es:
1. Auf den Link unten klicken oder QR-Code scannen!
2. Auf „Kanal ansehen“ klicken!
3. Den Kanal abonnieren!
4. Die Glocke oben rechts aktivieren!
👉 Jetzt abonnieren: https://whatsapp.com/channel/0029Vb57hSjI7Be6L2z9yz2a
oder hier:

Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Am 22. Mai 2025 stimmte das Plenum des Europäischen Parlaments mit 411 Ja-Stimmen, 100 Nein-Stimmen und 78 Enthaltungen für den Kommissionsvorschlag ohne Änderungen zur schrittweisen Erhöhung der Wertzölle auf stickstoffhaltige Düngemittel aus Russland und Belarus. Das Parlament folgt damit den Mitgliedstaaten,
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Bildungsvertreter vom Haupt- und Ehrenamt aller Landesverbände trafen sich am 19. und 20. Mai im hessischen Friedrichsdorf zur jährlich stattfindenden Präsenzveranstaltung des Fachausschuss Berufsbildung und Bildungspolitik des Deutschen Bauernverbandes (DBV).
Torben Eppstein und Anne Fay vom gastgebenden hessischen Bauernverband stellten die Ausbildung in den grünen Berufen in Hessen
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Am 5. Juni, ab 9:00 Uhr findet der Feldtag zur Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz statt. Der vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum geplante Feldtag findet auf einem Versuchsfeld des Landwirtschaftlichen Zentrums „Hörseltal“ e.G. Mechterstädt im Landkreis Gotha statt.
Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl zwingend erforderlich.
Bitte melden Sie sich bis spätestens 02. Juni 2025 bei Katrin Ewert unter Tel.: +49 (0)361 574 047 101 oder E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! an.
Das Programm gibt es hier.
Foto: TLLLR
Am 21. Mai hat die Europäische Kommission die Durchführungsverordnung zur Nicht-Zulassung von Flufenacet veröffentlicht. Demnach müssen die Mitgliedstaaten spätestens am 10. Dezember 2025 die Zulassungen für Pflanzenschutzmittel aufheben, die Flufenacet als Wirkstoff erhalten. Damit wurde die Genehmigung für den Wirkstoff Flufenacet trotz
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Hermann Färber erneut Ausschussvorsitzender des Landwirtschaftsausschusses
DBV/ TBV Donnerstag, 22. Mai 2025In den Ausschüssen des Deutschen Bundestages werden Gesetzgebungen vorbereitet, beraten und koordiniert. In der vergangenen Woche hat der Bundestag seine Ausschüsse eingesetzt.
Am Mittwoch (21. Mai) fand die konstituierende Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat statt. Der CDU-Abgeordnete Hermann Färber wurde dabei mit 29 von 30 möglichen Stimmen erneut zum Vorsitzenden des Ausschusses gewählt.
Anbei erhalten Sie einen Überblick über den Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat sowie über den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, in dem Lorenz Gösta Beutin (Die Linke) zum Vorsitzenden gewählt wurde.
Zugangsbeschränkung
Dieser Inhalt steht exklusiv TBV-Mitgliedern zur Verfügung.
Um diesen Inhalt zu sehen, melden Sie sich bitte an: zur Anmeldung Mitglied werden
Alfred-Hess-Straße 8
99094 Erfurt
Tel.: +49 (0)361 262 530
Fax: +49 (0)361 262 532 25
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



